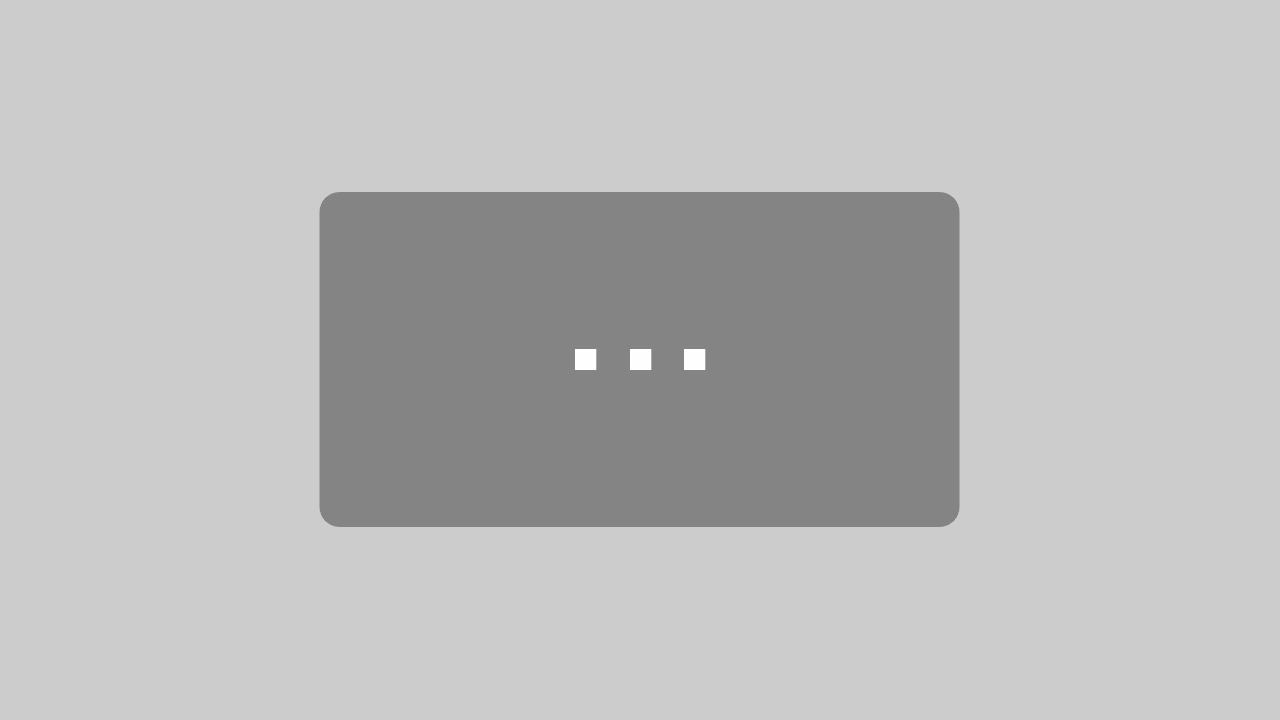Vitamin A sorgt insbesondere für den Erhalt der Sehkraft sowie der Haut und der Schleimhäute. Seine Vorstufe, das Beta-Carotin, kommt in Karotten und anderen orange-roten Lebensmitteln vor. Zu einer ausreichenden Zufuhr können auch Nahrungsergänzungsmittel beitragen.
Informationen zu Funktion, Zufuhrempfehlungen und Quellen für Vitamin A gibt dieses Grafikvideo des Lebensmittelverbands Deutschland in Kurzform:
Welche Funktion hat Vitamin A im Körper und für die Gesundheit?
Der Begriff „Vitamin A“ umfasst eine Vielzahl von Stoffen, die im Körper eine ähnliche Wirkung entfalten. Am Bekanntesten ist das Retinol. Beta-Carotin, eine Vorstufe von Vitamin A, wird im Körper in Vitamin A umgewandelt.
Vitamin A ist für die Funktion des Sehvorgangs und des Immunsystems notwendig. Außerdem regelt es den Aufbau und die Funktion von Haut und Schleimhaut.
Vitamin A fördert Erhalt und Funktion der/des
- Sehkraft
- Haut
- Schleimhaut
- Immunsystems
Wie ist die Zufuhrempfehlung für Vitamin A?
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt für Erwachsene eine tägliche Zufuhr von 700 (Frauen) – 850 (Männer) μg Vitamin A (Retinolaktivitätsäquivalent). Für Kinder (eins bis unter 13 Jahren) liegt die empfohlene Zufuhr altersabhängig niedriger. Schwangeren und Stillenden werden 800 bzw. 1300 μg Retinolaktivitätsäquivalent/Tag empfohlen. 1 μg Retinolaktivitätsäquivalent entspricht dabei 1 μg Retinol oder 12 μg Beta-Carotin oder 24 μg andere Provitamin-A-Carotinoide.
Wie ist die Versorgungslage mit Vitamin A in Deutschland?
Die Versorgung mit Vitamin A (aus Vitamin A und Provitamin A) ist bei den üblichen Ernährungsgewohnheiten im Durchschnitt gut (DGE). 15 Prozent der Männer und 10 Prozent der Frauen erreichen in Deutschland die empfohlene tägliche Zufuhr, gemessen in Retinoläquivalenten, jedoch nicht. Diese Anteile sind bei Männern und Frauen in der jüngsten Altersgruppe am höchsten (29 Prozent bei den Männern, 25 Prozent bei den Frauen, NVSII). Auch bei Kindern zwischen zwei und 15 Jahren liegt die mittlere Zufuhr unter den Zufuhrempfehlungen für diese Altersgruppe.
Wie kann man den Bedarf an Vitamin A decken?
Vitamin A kommt vor allem in Leber vor, während seine Vorstufe, das Beta-Carotin, natürlicherweise in Gemüse wie Karotten, Paprika und Blattgemüsen enthalten ist.
Welche Bevölkerungsgruppen haben ein erhöhtes Risiko?
Trotz der im Durchschnitt guten Versorgung mit Vitamin A kann es für folgende Gruppen schwierig sein, den Bedarf an Vitamin A zu decken:
- Neugeborene (Versorgung abhängig vom Vitaminstatus der Mutter)
- Kinder mit wiederkehrenden Infektionen (erhöhter Bedarf und evtl. nicht optimale Zufuhr)
- Vegetarier und Veganer (durch den Verzicht auf tierische Produkte wie Leber)
- Schwangere und Stillende: Bei ihnen ist der Bedarf um 40 bzw. 90 Prozent erhöht. Insbesondere bei einer fleischarmen Ernährungsweise ist die Versorgung reduziert. Eine gute Vitamin-A-Versorgung der Mutter ist jedoch die Voraussetzung für die Versorgung des Kindes.
- Ältere Menschen
Welche gesundheitsbezogene Aussagen dürfen gemacht werden?
Basierend auf Gutachten der europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), die die wissenschaftliche Datenlage geprüft hat, sind folgende gesundheitsbezogene Aussagen zu Vitamin A von der Europäischen Kommission zur Auslobung zugelassen:
Vitamin A
- trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei.
- trägt zur Erhaltung normaler Haut bei.
- trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei.
- trägt zu einem normalen Eisenstoffwechsel bei.
- trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
- spielt eine Rolle bei der Zellspezialisierung.
Schon gewusst?
Die Nutzung von Beta-Carotin aus Gemüse hängt in hohem Maße von der Art der Zubereitung ab. Aus rohen Karotten wird Beta-Carotin praktisch nicht absorbiert, während es in Form von Saft oder in gekochtem Zustand gut vom Körper aufgenommen wird.
Die DGE hat in 2020 die Zufuhrempfehlungen für Vitamin A auf eine neue Einheit umgestellt. Zuvor wurden die Empfehlungen in Retinoläquivalenten angegeben, nun jedoch in Retinolaktivitätsäquivalenten.